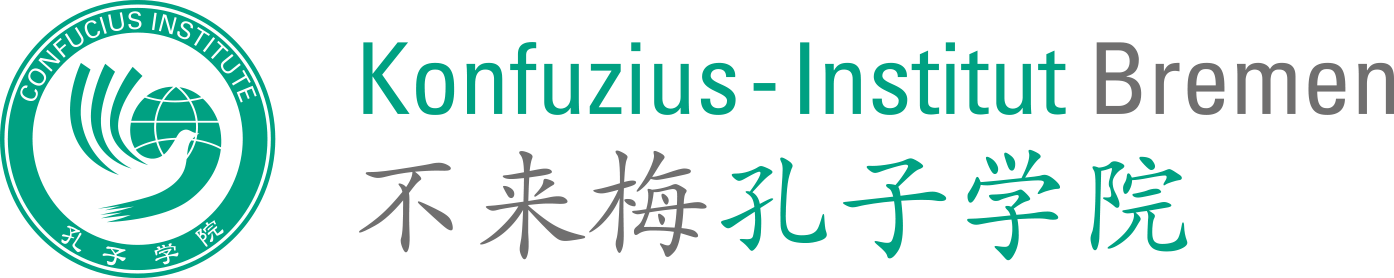Teilnahme vor Ort im Haus der Wissenschaft oder Online über Zoom. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten (siehe unten).
Frau Ruirui Zhou
Wie in vielen anderen Ländern gilt wirtschaftlicher Nationalismus in China als Baustein der historischen Konstellation eines Nationalstaates. Er trägt zur Herstellung einer Markteinheit, die als ein wichtiger Bestandteil der modernen bürgerlichen Nation fungiert, bei. Die (Wieder-)Konstruktion der nationalen Identität gehört zu der konstitutionellen Agenda der chinesischen Modernisierung.
Seit über hundert Jahren ergänzten sich das Konzept des wirtschaftlichen Nationalismus „Chinesen verwenden chinesische Produkte“ mit Chinas aufkeimenden Konsumkultur miteinander und prägten die Unterscheidung zwischen „einheimischen Produkten“ und „ausländischen Produkten“ mit jeweiligen anderen kulturellen Unterlegungen im Modernisierungsprozess. Durch die "inländischen Warenbewegung" von 20en bis 40en Jahren und von 50en bis Ende 70er Jahren wurden die Begriffe "Nationalstaat" und "Patriotismus" gestärkt. Hingegen beziehen sich die positiven Vorurteile über die westlichen Waren in China nicht nur auf die reale Qualität der Waren, sondern sie verkörpern auch ein Ideal des anzustrebenden gesellschaftlichen Zustandes des Staates: Länder, welche sich erst durch Industrialisierung und Modernisierung stark gemacht haben.
Anders als die ersten zwei ist die dritte Welle der „inländischen Warenbewegung“ ein Produkt des globalisierten, von den New Medien geprägten Vernetzungsmarktes und dessen kulturellen Umfelds. Ihre Akteure und deren Handlungsweisen, Diskursmuster und emotionalen Strukturen sind allesamt in der globalisierten Marktwirtschaft und -gesellschaft verwurzelt, weisen aber die Merkmale einer „de-globalisierenden (nationalistischen) Globalisierung“ auf. Das Kaufverhalten einheimischer Waren ist eine externalisierte Manifestation von Identitätspolitik, die ursprünglich eine emotionale Politik ist, die von der emotionalen Erfahrung in einer bestimmten Situation abhängt. Verglichen mit in den ersten zwei „einheimischen Warenbewegungen“ führen beispielsweise viele nationale Trendprodukte keinen einfachen Preiskampf mehr. Stattdessen versuchen sie positive Vorurteile herzustellen, die früher ausschließlich die den westlichen Waren zugeschrieben wurden: Erfüllung der ästhetischen Ansprüche, Individualisierung der Angebote usw. War in den ersten zwei „einheimischen Warenbewegungen“ die Konsumsentscheidung für nationale Produkte eher ein Ergebnis aus mangelnder Auswahl oder hoher Preise der westlichen Waren, ist es in der dem aktuelle Boom nach der Diversifizierung der Angebote eher eine selbstsuchende Rückkehr zur traditionellen Werten und Ästhetik.
Wenn Waren und Markenleistungen als gebündelte soziale Wille ganzer Sozialitäten zu konzipieren sind, spiegeln in ihnen wie unter einem Brennglas der Leistungswille und die Kreativität ganzer Völker, die sich als wichtige Merkmale ihrer Eigenwahrnehmung und Identität darstellen, wider. Somit ist der wirtschaftliche Nationalismus in der dritten Welle der „einheimischen Warenbewegung“ auch Ausdruck einer Identitätspolitik, die vom Staatswillen und der jüngeren Generation der entstehenden urbanen Mittelschicht, die ihre Identität im Kontext der Globalisierung neu entdecken will, gemeinsam gefördert und konstruiert wird.
Ruirui Zhou, © Miguel Ferraz
Ruirui Zhou ist Soziologin an der Universität Hamburg. In ihrer wissenschaftlichen Arbeit konzentriert sie sich auf Kulturpolitik im internationalen Vergleich, die Modernitätskonstruktion sowie Kultursoziologie mit Publikationen u.a. zu Kulturpolitikforschung, Kulturgeschichte, Kultursoziologie und Kulturentwicklung. Darüber hinaus ist sie als Kolumnistin tätig u.a. für chinesisch-sprachige Medien sowohl innerhalb als auch außerhalb des chinesischen Festlandes zu Themen wie Deutschlandbild, deutsche/europäische Gesellschaft sowie deutsch-chinesische Beziehungen.
Hier geht’s zur Registrierung für die Zoom-Veranstaltung.
Um Anmeldung zur Präsenzveranstaltung wird gebeten (entweder mit folgendem Formular oder per Mail an (veranstaltung@konfuzius-institut-bremen.de).